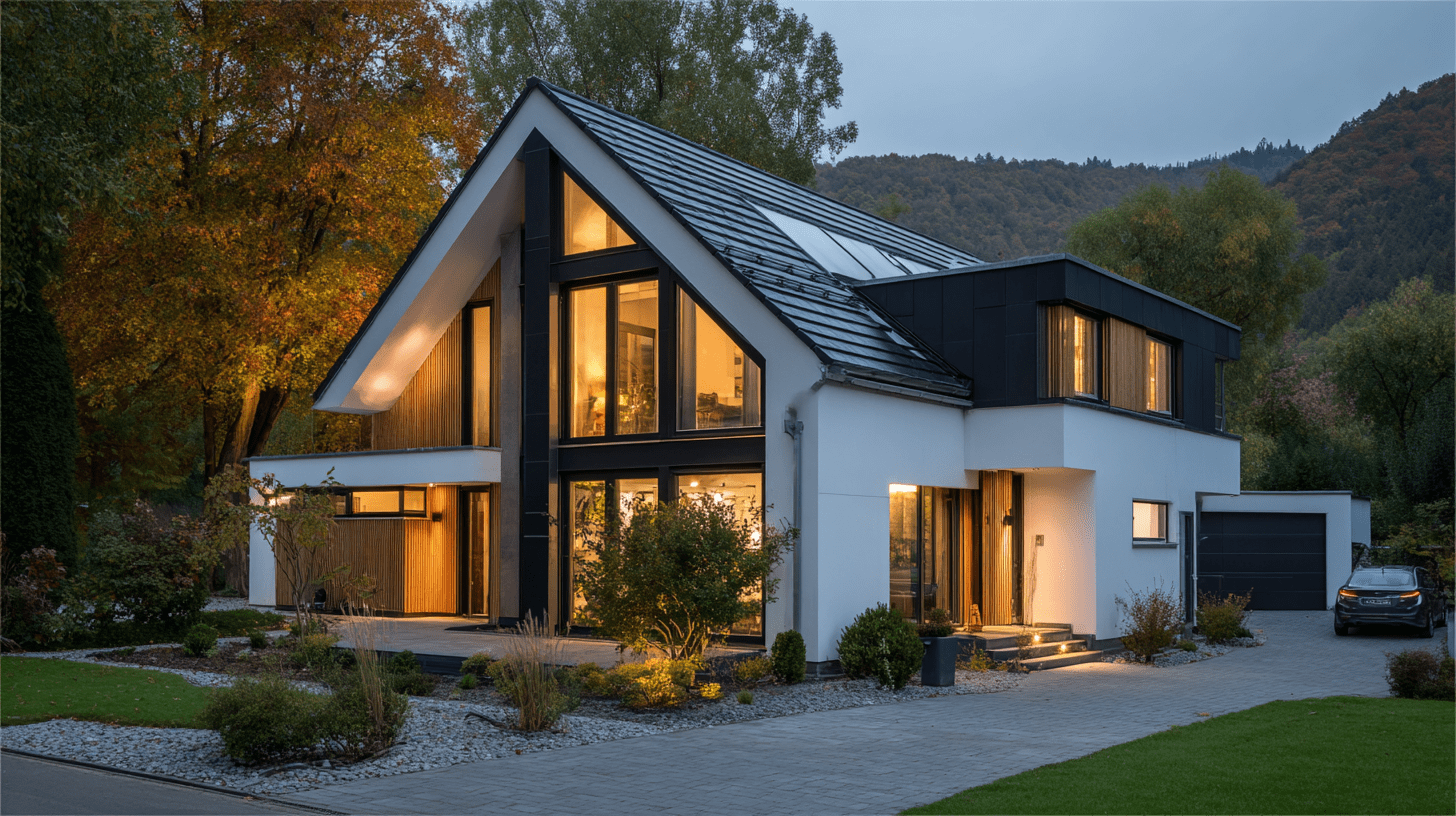Das Gebäudeenergiegesetz 2025 bringt wichtige Änderungen für Hauseigentümer und Bauherren. Seit 2024 gelten neue Vorgaben für neue Heizungen, die den Klimaschutz vorantreiben sollen. Dieser Artikel erklärt Ihnen die Regelungen des GEG verständlich und zeigt, was Sie konkret beachten müssen.
Das Wichtigste in Kürze
- Das GEG schreibt vor, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme betrieben werden müssen (§ 71 Abs. 1 GEG)
- Für Neubauten in Neubaugebieten gelten die Anforderungen seit 01.01.2024; für Bestandsgebäude erst nach Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung: Mitte 2026 (Kommunen über 100.000 Einwohner) oder Mitte 2028 (kleinere Kommunen) (§ 71 Abs. 8 GEG)
- Übergangsfristen bei Heizungsdefekt: mindestens 5 Jahre, bei Etagenheizungen bis zu 13 Jahre, bei geplantem Wärmenetzanschluss bis zu 10 Jahre (§ 71i, § 71j, § 71l GEG)
- Bestehende Heizungen haben Bestandsschutz und dürfen repariert werden (§ 72 GEG)
- Der Staat unterstützt den Heizungstausch seit 2024 über die KfW (Programm 458) mit bis zu 70 Prozent Förderung (KfW)
- Fossile Brennstoffe dürfen längstens bis 31.12.2044 genutzt werden (§ 72 Abs. 4 GEG)
Was regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Das Gebäudeenergiegesetz ist das zentrale Regelwerk für energetische Anforderungen an Gebäude in Deutschland. Es regelt, wie viel Energie Immobilien verbrauchen dürfen und welche Heizungen zulässig sind.
Das GEG vereint seit dem 01.11.2020 die frühere Energieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinspargesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) (gesetze-im-internet.de). Die Vorschriften betreffen sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude und definieren Anforderungen an die energetische Qualität von Wohngebäuden.
Dabei geht es nicht nur um die Heizung, sondern auch um Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard. Das GEG setzt damit einen wichtigen Rahmen für die Energiewende im Gebäudesektor.
Die wichtigsten Änderungen
Das neue Gebäudeenergiegesetz bringt einen grundlegenden Wandel bei der Heizungswahl. Während früher noch fossil betriebene Heizungen ohne Einschränkung erlaubt waren, müssen neue Anlagen nun zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme arbeiten (§ 71 Abs. 1 GEG).
Die Vorgaben des GEG zielen darauf ab, den Energieverbrauch in Gebäuden deutlich zu senken und die Klimaziele zu erreichen. Bis 31.12.2044 dürfen Heizungen mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, danach müssen alle Heizungen klimaneutral sein (§ 72 Abs. 4 GEG).
Welche Regelungen gelten ab wann?
Die 65-Prozent-Regel gilt nicht pauschal “ab 2025”, sondern differenziert:
Für Neubauten in Neubaugebieten: seit 01.01.2024
Für Bestandsgebäude und Neubauten in Baulücken: erst nach Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung:
- Großstädte (über 100.000 Einwohner): spätestens ab 30.06.2026
- Kleinere Kommunen: spätestens ab 30.06.2028
Bis zu diesen Fristen können noch Öl- und Gasheizungen eingebaut werden, allerdings mit stufenweisen Anforderungen ab 2029 (§ 71 Abs. 9 GEG): → Ab 01.01.2029: mindestens 15% Biomasse oder grüner/blauer Wasserstoff
→ Ab 01.01.2035: mindestens 30%
→ Ab 01.01.2040: mindestens 60%
Bestehende Heizungen haben Bestandsschutz (§ 72 GEG). Sie dürfen weiterlaufen und repariert werden. Erst bei einem Heizungstausch greifen die neuen Anforderungen.

Heizungsgesetz für Neubauten im GEG
Für Neubauten in Neubaugebieten gelten die strengsten Vorgaben. Hier müssen Bauherren seit 01.01.2024 beachten, dass neue Heizungen mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme zu mindestens 65 Prozent betrieben werden müssen (§ 71 Abs. 1 GEG).
Das GEG müssen Architekten und Bauherren von Beginn an in die Planung einbeziehen. Die Anforderungen für Neubauten sind in § 10 GEG klar definiert: Der Jahres-Primärenergiebedarf darf den des Referenzgebäudes nicht überschreiten.
Dabei spielt nicht nur die Heizung eine Rolle, sondern auch die Dämmung und die Gebäudehülle. Ein ganzheitlicher Ansatz ist hier entscheidend für die Energieeffizienz.
Anforderungen an erneuerbare Energien im Neubau
Im Neubau ist der Einsatz erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme zu mindestens 65 Prozent verpflichtend (§ 71 GEG). Die Nutzung muss gemäß dem Gebäudeenergiegesetz nachgewiesen werden.
Dabei haben Bauherren verschiedene Optionen:
- Wärmepumpen
- Solarthermie
- Biomasseheizungen
- Anschluss an ein Wärmenetz
- Unvermeidbare Abwärme
Besonders beliebt sind Wärmepumpen, da sie effizient arbeiten und die Anforderungen problemlos erfüllen (§ 71 Abs. 2 und 3 GEG). Sie entziehen der Umgebung Wärme und erhöhen diese auf Heiztemperatur. Bei guter Planung erreichen sie die geforderte Quote mühelos.
Welche Heizungen sind laut GEG erlaubt?
Laut GEG sind verschiedene Heizsysteme zulässig, solange sie die 65-Prozent-Regel erfüllen (§ 71 Abs. 2 GEG).
Dazu gehören:
- Elektrische Wärmepumpen
- Biomasseheizungen
- Solarthermieanlagen in Kombination mit anderen Systemen
- Anschluss an Nah- oder Fernwärmenetze
- Stromdirektheizungen (bei Erfüllung bestimmter Bedingungen)
- Wärmepumpen- und Solarthermie-Hybridheizungen
Auch Hybridheizungen sind möglich, wenn der erneuerbare Anteil mindestens 65 Prozent beträgt. Gasheizungen können Teil solcher Hybridsysteme sein, wenn sie mit einer Wärmepumpe oder Solarthermie kombiniert werden.
Das GEG lässt dabei technologieoffen verschiedene Lösungen zu. Wichtig ist nur das Ergebnis: 65 Prozent mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme.
Bestandsgebäude: Was gilt für bestehende Gebäude?
Für Bestandsgebäude gelten weniger strenge Regelungen als für Neubauten. Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben und bei Defekten auch repariert werden (§ 72 GEG).
Das GEG sieht hier keine sofortige Austauschpflicht vor, was vielen Eigentümern Planungssicherheit gibt. Erst wenn eine Heizung irreparabel kaputt ist, greifen Übergangsfristen.
Müssen Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden?
Nein, bestehende Öl- und Gasheizungen müssen nicht sofort ausgetauscht werden. Sie genießen Bestandsschutz und dürfen weiterlaufen, solange sie funktionieren (§ 72 GEG). Selbst Reparaturen sind weiterhin erlaubt, auch wenn Bauteile ausgetauscht werden müssen.
Allerdings gibt es Austauschpflichten für besonders alte Heizkessel:
Nur Konstanttemperaturkessel (auch Standardkessel genannt), die älter als 30 Jahre sind, müssen ausgetauscht werden (§ 72 Abs. 1 und 2 GEG). Niedertemperaturkessel und Brennwertkessel sind von dieser Austauschpflicht ausgenommen.
Ausnahmen:
Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die ihre Immobilie bereits vor dem 01.02.2002 selbst bewohnt haben, müssen ihre Heizung nicht austauschen (§ 73 GEG). Bei Eigentümerwechsel muss die Pflicht vom neuen Eigentümer innerhalb von zwei Jahren erfüllt werden.
Welche Übergangsfristen gelten bei Heizungsdefekt?
Wenn eine Heizung nach Geltung der 65-Prozent-Regel irreparabel kaputt geht, gibt es großzügige Übergangsfristen (§ 71i GEG):
Allgemeine Übergangsfrist: bis zu 5 Jahre
In dieser Zeit darf eine Übergangslösung (auch gebrauchte Heizung) eingebaut werden, die die 65-Prozent-Anforderung nicht erfüllt (§ 71i GEG).
Bei geplanter Wärmenetzversorgung: bis zu 10 Jahre
Wenn ein Anschluss an ein Wärmenetz geplant ist, verlängert sich die Frist (§ 71j GEG). Scheitert der Anschluss, gibt es weitere 3 Jahre Zeit.
Bei Etagenheizungen: bis zu 13 Jahre
In Gebäuden mit Etagenheizungen gilt eine 5-Jahres-Frist für die Entscheidung über das künftige Heizsystem. Bei Umstellung auf Zentralheizung verlängert sich die Frist um bis zu 8 Jahre (§ 71l GEG).
Eine energetische Sanierung der gesamten Gebäudehülle ist nicht verpflichtend. Das GEG fokussiert sich primär auf die Heizungstechnik.

Kommunale Wärmeplanung und ihre Bedeutung
Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentrales Element des GEG 2025. Kommunen müssen bis Mitte 2026 (über 100.000 Einwohner) bzw. Mitte 2028 (kleinere Kommunen) Pläne erstellen, wie sie ihre Wärmeversorgung künftig klimaneutral gestalten (Wärmeplanungsgesetz).
Diese Pläne zeigen: → Wo Wärmenetze ausgebaut werden
→ Welche Gebiete auf dezentrale Lösungen setzen
Für Eigentümer ist die kommunale Wärmeplanung wichtig, weil sie bestimmt, ab wann die GEG-Anforderungen greifen. Liegt der Plan vor, haben sie Klarheit über ihre Optionen.
Wie hängen kommunale Wärmeplanung und GEG zusammen?
Das GEG und die kommunale Wärmeplanung sind eng verzahnt (§ 71 Abs. 8 GEG). Die Wärmeplanung gibt die Rahmenbedingungen vor, das GEG definiert die technischen Anforderungen.
Erst wenn die Kommune ihren Plan vorgelegt hat (oder die Fristen 2026/2028 ablaufen), wissen Eigentümer genau, welche Heizoptionen langfristig verfügbar sind. In Gebieten mit geplantem Wärmenetzausbau können Eigentümer auf den Netzanschluss warten. Andernorts müssen sie auf individuelle Lösungen setzen.
Diese Koordination soll Fehlinvestitionen vermeiden und eine effiziente Infrastruktur ermöglichen.
Heizungsoptionen: Von fossil zu erneuerbar umsteigen
Der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energie oder unvermeidbare Abwärme ist der Kern des GEG. Eigentümer haben dabei verschiedene Technologien zur Auswahl, je nach Gebäude und örtlichen Gegebenheiten.
Wärmepumpen: Die effiziente Alternative
Die beliebteste Lösung, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen. Wärmepumpen nutzen Umweltwärme aus Luft, Erde oder Grundwasser und wandeln diese in Heizenergie um (§ 71c GEG).
Dabei arbeiten moderne Wärmepumpen sehr effizient und erreichen problemlos die geforderte 65-Prozent-Quote. Besonders Luft-Wasser-Wärmepumpen sind einfach zu installieren und eignen sich für viele Gebäude.
Die verschiedenen Typen:
- Luft-Wasser-Wärmepumpen: Einfache Installation, für die meisten Gebäude geeignet
- Sole-Wasser-Wärmepumpen: Höhere Effizienz, erfordern Erdarbeiten
- Wasser-Wasser-Wärmepumpen: Sehr effizient, benötigen Brunnenbohrungen
Der Einbau einer Wärmepumpe lohnt sich besonders in gut gedämmten Gebäuden mit Flächenheizungen. Bei älteren Immobilien sollte man prüfen, ob energetische Maßnahmen die Effizienz verbessern können.
Mehr dazu im Beitrag „Wärmepumpe Installation: Was Sie nach GEG 2025 wissen müssen“
Gasheizungen: Was ist noch erlaubt?
Reine Gasheizungen erfüllen die Vorgaben des GEG nach Ablauf der Übergangsfristen nicht mehr (§ 71 GEG). Erlaubt sind jedoch Hybridheizungen, die Gas mit erneuerbaren Energien kombinieren (§ 71h GEG).
Bis zu den Fristen 2026/2028 können noch Gasheizungen eingebaut werden, allerdings mit stufenweisen Bio-Anteil-Pflichten ab 2029 (15%, 30%, 60%).
H2-ready-Gasheizungen:
Eine weitere Option sind “H2-ready”-Gasheizungen, die später auf Wasserstoff umgerüstet werden können (§ 71k GEG). Wichtig: Diese sind nur zulässig, wenn ein verbindlicher, von der Bundesnetzagentur genehmigter Fahrplan für die Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff vorliegt. Scheitert der Wasserstoffanschluss, müssen Eigentümer innerhalb von 3 Jahren auf eine 65-Prozent-EE-Heizung umstellen.
Viele Experten raten zu vollständig erneuerbaren Systemen, um künftige Unsicherheiten zu vermeiden.
Erneuerbare Energie: Welche Optionen gibt es?
Es gibt weitere erneuerbare Optionen. Biomasseheizungen nutzen Holzpellets oder Hackschnitzel als nachwachsenden Brennstoff (§ 71c GEG). Sie eignen sich besonders für größere Gebäude oder ländliche Regionen mit guter Brennstoffversorgung.
Solarthermie kann als Ergänzung dienen, deckt aber selten den gesamten Heizbedarf (§ 71h GEG). In Kombination mit anderen Systemen trägt sie jedoch effektiv zur erneuerbaren Quote bei.
Der Anschluss an ein Fernwärmenetz ist eine komfortable Lösung, sofern verfügbar (§ 71b GEG). Hierbei erfolgt die Wärmeversorgung zentral, was besonders in städtischen Gebieten sinnvoll sein kann.
Welches System optimal ist, hängt vom Gebäude, der Lage und den individuellen Bedürfnissen ab. Eine professionelle Energieberatung hilft, die beste Lösung zu finden und die Anforderungen des GEG zu erfüllen.

Förderung für die Modernisierung der Heizung
Der Staat unterstützt den Heizungstausch mit umfangreichen Förderprogrammen nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Wichtige Änderung: Seit 01.01.2024 ist die KfW (nicht mehr das BAFA) für die Heizungsförderung zuständig (KfW).
Die Förderung läuft über das KfW-Programm 458. Die Basisförderung beträgt 30 Prozent der förderfähigen Kosten (KfW 458).
Hinzu kommen Boni:
- Klimageschwindigkeitsbonus: 20 % bei Austausch bis 2028 (danach abschmelzend um 3 Prozentpunkte alle 2 Jahre)
- Einkommensbonus: 30 % für Haushalte mit zu versteuerndem Jahreseinkommen unter 40.000 Euro
- Effizienzbonus: 5 % für besonders effiziente Wärmepumpen
Insgesamt sind bis zu 70 Prozent Förderung möglich, maximal jedoch 21.000 Euro (23.500 Euro bei Biomasse-Heizungen) bei Selbstnutzung (KfW). Diese Unterstützung macht die Modernisierung deutlich erschwinglicher.
Welche Förderungen gibt es?
Die Förderung erfolgt nach den BEG-Richtlinien und unterstützt alle Technologien, die die 65-Prozent-Regel erfüllen.
Förderfähig sind:
- Wärmepumpen
- Biomasseheizungen
- Solarthermieanlagen
- Anschluss an Wärmenetze
- Hybridheizungen mit erneuerbaren Energien
Wichtig: Der Förderantrag muss vor Beginn der Maßnahme bei der KfW gestellt werden (KfW 458). Die Heizung muss von einem Fachbetrieb installiert werden.
Beratungspflicht:
Vor dem Einbau einer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizung ist eine verpflichtende Beratung vorgeschrieben (§ 71 Abs. 11 GEG). Diese kann durch einen Energieberater, Installateur oder Schornsteinfeger erfolgen.
Das BAFA ist seit 2024 nur noch zuständig für:
- Gebäudehülle (Dämmung, Fenster)
- Anlagentechnik (außer Heizung)
- Heizungsoptimierung
MEHR ZUR FÖRDERUNG ERFAHREN SIE IN DIESEM ARTIKEL:
Förderung für die energetische Sanierung: Zuschuss & Fördermittel
Klimaschutz durch das Gebäudeenergiegesetz
Das GEG ist ein zentrales Instrument für den Klimaschutz in Deutschland. Gebäude verursachen etwa 30 Prozent der CO₂-Emissionen, vor allem durch Heizungen mit fossilen Brennstoffen (dena, Gebäudereport).
Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist daher entscheidend, um die Klimaziele zu erreichen. Bis 31.12.2044 dürfen fossile Brennstoffe für Heizungen genutzt werden, danach müssen alle Heizungen klimaneutral sein (§ 72 Abs. 4 GEG). Das GEG schafft dafür den rechtlichen Rahmen und gibt klare Vorgaben vor.
Gleichzeitig soll die Transformation sozialverträglich gestaltet werden, weshalb es Förderungen und lange Übergangsfristen gibt.
Wie trägt das GEG zum Klimaschutz bei?
Indem das GEG den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorschreibt, reduziert es die CO₂-Emissionen im Gebäudebereich systematisch. Jede neue Heizung, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, vermeidet über ihre Lebensdauer mehrere Tonnen CO₂.
Zudem schafft das Gesetz Planungssicherheit für Industrie und Handwerk. Hersteller können in die Produktion klimafreundlicher Heiztechnik investieren, Installateure sich auf die neuen Technologien spezialisieren. Diese Transformation stärkt auch die Wirtschaft und schafft neue Arbeitsplätze.
Langfristig profitieren alle: Das Klima wird geschützt, die Abhängigkeit von fossilen Importen sinkt, und moderne Heizungen sind effizienter und langfristig kostengünstiger.
Praktische Tipps für die Umsetzung des GEG
Die Umsetzung des GEG erfordert sorgfältige Planung. Wer jetzt schon an den Heizungstausch denkt, hat mehr Zeit und Optionen.
Erste Schritte: → Die kommunale Wärmeplanung einsehen
→ Eine Energieberatung in Anspruch nehmen
→ Angebote von Fachbetrieben einholen
Wichtig ist auch, das Gebäude ganzheitlich zu betrachten. Eine neue Heizung arbeitet effizienter in einem gut gedämmten Gebäude. Manchmal lohnt sich daher eine energetische Sanierung parallel zum Heizungstausch, um den Energieverbrauch nachhaltig zu senken.
Effizient sanieren: Was ist zu beachten?
Beim Sanieren sollte man nicht nur die Heizung, sondern auch Dämmung, Fenster und Lüftung einbeziehen. Ein ganzheitliches Konzept steigert die Effizienz und erfüllt die Anforderungen des GEG optimal.
Eine professionelle Energieberatung deckt Einsparpotenziale auf und hilft bei der Planung. Förderungen gibt es nicht nur für Heizungen, sondern auch für Dämmmaßnahmen (BAFA).
Die Vorteile:
- Wirtschaftlich attraktive Modernisierung durch geschickte Kombination von Maßnahmen
- Steigerung des Immobilienwerts durch energetische Verbesserungen
- Langfristige Senkung der Energiekosten
- Verbesserung des Wohnkomforts
Unser Rat aus der Praxis: Nehmen Sie sich Zeit für die Planung, holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Regelung des GEG mit ihren Übergangsfristen gibt Ihnen Spielraum – nutzen Sie ihn für eine durchdachte Entscheidung.